
Was für eine geniale Tante!
20 April 2021
Der Frosch
14 Juli 2021Was Erin entdeckt (Leseprobe)

1 Das Wunderhorn
Als Erin sich mit der Urne auf dem Arm endlich einen Weg durch die kleine Dreizimmerwohnung gepflügt hatte und in den Raum gelangte, der eigentlich einmal eine Stube gewesen war, sah sie ihn zuoberst auf dem Regal liegen. Ein Gipsabdruck von den Zähnen ihres Vaters, der vor vielen Jahren für seine Zahnprothese hergestellt wurde, wäre ihr lieber gewesen! Zuoberst auf dem Regal aber lag sein Penis, aus weissem Gips und in voller Länge. Steif für alle Zeit und Ewigkeit. Dass es seiner war, wusste sie, weil er ihn ihr vor etwa zehn Jahren einmal stolz lachend als «bijou de famille», als Kronjuwel, entgegengestreckt hatte, als sie auf Besuch gewesen war. Vom Französischen konnte ihr Vater zwar nur ein paar Brocken, aber diesen Ausdruck hatte er einmal bei einer Freundin aufgeschnappt und nie vergessen.
Kurze Zeit bevor er sich mit seinem verewigten Phallus vor Erin brüstete, hatte er sich mit dem Gutschein, den sie ihm zu Weihnachten geschenkt hatte, einen kreativen Migros-Kurs geleistet, wo er den praktischen Umgang mit Gipsbändern und Alginat gelernt hatte. Natürlich, so erklärte er ihr ohne jede Scham, wie es schon immer seine Art war, habe sich sein Penis nach Abschluss des Kurses als Modell bestens geeignet, stand er ihm im wahrsten Sinne des Wortes doch gratis und franko täglich zur Verfügung und liess er sich zu jener Zeit auch noch problemlos und innert Sekunden in die gewünschte Stellung bringen. Sie selber war damals Anfang vierzig gewesen, ziemlich abgebrüht, was die jahrelangen Extravaganzen ihres Vaters seit ihrer Kindheit in den 70er-Jahren betraf.
Sie stellte die Urne einen Moment auf das einzige freie Fleckchen vor ihren Füssen, stieg auf einen Schemel, von dem sie zuerst die meterhohe Zeitungsbündelschicht hatte entfernen müssen, und langte mit hochgezogenen Augenbrauen nach dem kalten, glatten aber leicht angestaubten Gips. Dieses Relikt ihres Vaters – mit einer Eichel so rund wie seine Glatze – konnte sie wirklich nicht in der Wohnung lassen, bis das Räumungsinstitut sich darum kümmern würde. Es reichte, wenn sie allein von dieser Peinlichkeit Kenntnis hatte. Am besten würde sie das Unding gleich zertrümmern und mit einem Teil des ganzen undefinierbaren, nicht recycelbaren Mülls für den Hauskericht bereitstellen, wofür die Räumungsfirma bestimmt mehrere Mulden brauchen würde, in einem Herkules-Abfallsack der Migros. Sie hatte in kluger Voraussicht extra mehrere Rollen davon mitgebracht. Oder sollte sie es mitnehmen und am gleichen Ort versenken wie die Urne? Sollte sie diese tatsächlich in der Nähe des Rütlis über der stillen Wasserfläche des Vierwaldstättersees ausschütten, wie es ihr Vater immer gewünscht hatte, und den Gipspenis – sie hörte im Geiste schon das «Plop» – ins Wasser plumpsen lassen? Möglichst im Winter, wenn keine Touristen in der Nähe wären …
Sie steckte das Fossil ihres Vaters fürs Erste seufzend in ihre Handtasche, hob die Urne vom Boden auf und bahnte sich mit kleinen, vorsichtigen Schritten über die eingetrockneten Blut- und Urinspuren im Flur einen Weg in die Küche. Als sie es knapp schaffte, die Tür aufzustossen, wobei ihr zu ihrem Schrecken gleich eine Schar dicker Fliegen entgegenschwirrte, bemerkte sie sofort, dass das Chaos in diesem Raum etwas weniger gross, dass aber dafür der Schmutz und der Gestank umso krasser waren. Sie hielt sich automatisch die Nase zu und sah, vor Ekel geschüttelt, die bei der verkrusteten Arbeitsfläche auf vergammelten Essensresten wimmelnden Maden, die verdreckten Pfannen und die zerbrochenen Teller, Gläser und zerdrückten Joghurtbecher. Auf den Fliesen am Boden konnte sie kaum einen Fuss vor den anderen setzen, da dort die unzähligen leeren Wein- und Schnapsflaschen standen und weil sich in einer Ecke neben einem Wust von leeren Plastiksäcken geöffnete Konservenbüchsen mit nach oben gebogenen Deckeln und Verpackungen aller Art auftürmten. Erin standen die Haare zu Berge. Sie verliess die Küche rückwärtsgehend und schloss die Tür rasch wieder.
Eigentlich war sie nach dem Abholen der Urne im Krematorium im Friedental nur in diese schrecklich vermüllte Wohnung zurückgekehrt, weil sie noch einmal nach ein paar persönlichen Papieren ihres Vaters hatte suchen wollen, aber es ekelte sie nun doch, selber stundenlang in dem unvorstellbaren Chaos herumzuwühlen. Und sie musste auch wieder intensiv an den Schock zurückdenken, den sie erlitten hatte, als sie die Polizei vor zehn Tagen darum gebeten hatte, die Tür zur Wohnung ihres Vaters aufzubrechen, weil er auf ihr wiederholtes Klingeln hin nicht geantwortet hatte und auch per Telefon nicht erreichbar gewesen war. Ihr Vater hatte, nicht weit von der Eingangstür, im durch die Stapel von Zeitungen und allerhand Ramsch verengten Flur bäuchlings am Boden gelegen, sein Körper war schon erkaltet und seine Hände waren bläulich gewesen. Etwas Blut war ihm aus Nase und Mund gesickert und bei seiner Taille hatte es am Boden einen nassen Fleck gehabt. Die Augen waren halb geöffnet geblieben. Es sah nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall aus, jedenfalls konnte Erin sich nur etwas Derartiges vorstellen. Tatsächlich konstatierte der schnell herbeigerufene Arzt den Tod und die Autopsie, die wenige Tage später zwecks eindeutiger Klärung der Todesursache vorgenommen wurde, bestätigte, dass ihr Vater an einem Schlaganfall gestorben war. Für Erin war es eine Erleichterung gewesen, zu wissen, dass ihr Vater nicht lange hatte leiden müssen. Allerdings war er in der Stunde seines Todes ganz allein gewesen, das wiederum machte ihr zu schaffen. Sie hatte mehrere Nächte hintereinander Alpträume gehabt, in der sie immer wieder ihren tot am Boden liegenden Vater sah. Die psychologische Betreuung, die ihr die Polizei angeboten hatte, nachdem der Leichnam an jenem denkwürdigen Tag aus der Wohnung abgeholt worden war, hatte sie abgelehnt.
Als sie etwas erschöpft im Bus sass, der sie zum Bahnhof zurückbrachte, platzierte sie die Urne, die sie in eine Plastiktasche gestellt hatte, unter ihrem Jupe und zwischen ihren eleganten Stiefeletten auf dem Boden, damit sie nicht umkippte und versuchte, an etwas anderes zu denken, als an die Messie-Wohnung ihres Vaters, für deren Räumung sie als einzige Tochter verantwortlich war. Sie bedauerte wieder einmal, ein Einzelkind zu sein. Vor allem eine Schwester hätte sie in ihrer Kindheit gerne gehabt. So hätte sie jetzt zusammen mit ihr besprechen können, wie sich diese Räumung am besten organisieren und wie und wo sich die Asche ihres Vaters diskret verstreuen liesse. Auch mit der fehlenden Abdankungsfeier und dem befremdlichen Abholen der Urne im Krematorium – ihr Vater war überzeugter Atheist gewesen und hatte bereits in jungen Jahren immer betont, er wolle keine religiöse Feier und vor allem keinen Pfarrer, wenn dereinst seine Stunde geschlagen hätte und er nur noch Asche wäre –, hätte sie nicht allein zurechtkommen müssen. Sogar für den administrativen Kram, der sie nun erwartete, hätte sie Hilfe gehabt. Ihr Vater hatte sich nach seiner Pensionierung vor elf Jahren völlig abgeschottet, aber eigentlich hatte er auch schon vorher keinen einzigen Freund gehabt und hatte auch von den zahlreichen Freundinnen, die er in seinem Leben kennengelernt und beschlafen hatte, keine auf Dauer behalten können. Alle waren sie ihm davongelaufen. Wie auch ihre Mutter, Jahrzehnte zuvor.
Erin nahm ihr Smartphone aus ihrer Handtasche, aber dabei fiel ihr Blick wieder auf das peinliche Erbstück ihres Vaters. Am liebsten hätte sie es aus dem Busfenster über ihr geworfen, das trotz des kühlen Wetters schräg aufgeklappt war. Schliesslich nahm sie das Hermes-Seidenfoulard, das sie immer bei sich trug, und wickelte es im Innern ihrer Tasche um den Gips, nicht ohne sich vorher umzublicken, ob jemand in ihrer Nähe sass. Aber der Bus war zu ihrer Erleichterung fast leer, da er gerade erst die Endstation Matthof verlassen hatte. Nur etwas weiter vorne befanden sich zwei Passagiere: Eine junge Frau sass in Fahrtrichtung mit ihrem laut hechelnden schwarzen Hund auf dem Schoss hinter einem alten Mann mit schütterem Haar, der sich offenbar nicht vom warmen Hundeatem in seinem Nacken stören liess. Erin tippte, bei diesem Anblick erneut schaudernd, ihren Entsperrungscode in ihr Smartphone, checkte ihre Mails und ging kurz auf ihr Facebook-Profil. Es gab nur ein paar unwichtige Benachrichtigungen sowie eine persönliche Nachricht in Messenger. Neugierig öffnete sie sie, weil ihr der Name des Absenders nur vage bekannt vorkam. Ein Journalist, den sie nicht persönlich kannte, aber mit dem sie über eine Kulturgruppe vernetzt war, hatte ihr geschrieben. Als sie den ersten Satz las, dachte sie aber gleich, dass sie ihn als Kontakt wohl am besten blockieren würde. Plumpe Anmache war nicht ihr Ding, denn da stand: «Hallo Erin, möchten Sie eine Gratis-Reise mit mir machen? Näheres mündlich». Seine Telefonnummer hatte er ihr auch gleich daneben geschrieben. Sie würde sich hüten, ihn anzurufen. Es konnte auch irgendeine Masche eines Hackers sein, der das Profil des Journalisten missbrauchte, um an ihre Telefonnummer zu kommen oder der Journalist war selber gar kein Journalist, gab sich aber schon seit Monaten als solcher aus und seine angebotene Gratis-Reise war womöglich ein rein virtueller, verrückter LSD-Trip. An Spam-Mails für Ecstasy-Pillen war sie schon auf dem öffentlichen Kontaktformular ihrer Webseite gewohnt, es hätte sie nicht überrascht, auch auf Messenger solchen Mist angeboten zu bekommen. Bei Facebook war alles möglich. Man musste stets auf der Hut sein und Gefaktes war schon seit Längerem an der Tagesordnung.
Eine Reise aber, ja, die hätte sie gerne gemacht! Irgendwohin! Das Ziel wäre ihr völlig egal gewesen, denn so hätte sie sich nicht um die Entrümpelung der Wohnung ihres Vaters und die ganzen administrativen Belange kümmern müssen. Ja, und vielleicht hätte sie dann die Gelegenheit gehabt, die Asche ihres Vaters nicht ganz ohne Häme am anderen Ende der Welt zu verstreuen, statt im Herzen der Innerschweiz wie von ihm gewünscht, da er sein Lebtag nie gereist war. Geflüchtet wäre sie wirklich gerne, das musste sie sich eingestehen. Was zudem den Nachlass betraf, so gab es ausser lästiger Fossilien nichts zu erben von ihrem Vater. Die Summe vom Lottogewinn, bei dem er vor fast zwanzig Jahren zum ersten Mal in seinem Leben unverhofft zu etwas Geld gekommen war, hatte er längst aufgebraucht. Sie selber lebte seit Jahren nicht gerade auf Rosen gebettet, hatte aber ein bescheidenes, sicheres Auskommen über die Witwenrente, die sie seit dem Tod ihres Mannes vor sechs Jahren bezog. Und hie und da gab es doch ein paar zusätzliche Einnahmen über Lesungen und den Verkauf der zwölf Romane, die sie in den letzten zwanzig Jahren geschrieben hatte. Sie war in ihren eigenen Augen eine eigentlich talentierte Schriftstellerin, die den Sprung auf einen grünen Zweig mangels eines bedeutenden Verlags mit grossem Werbebudget allerdings kaum je schaffen würde. Zu dieser ernüchternden Erkenntnis war sie schon vor dem Ableben ihres Gatten und trotz des stetig guten, gar begeisterten Echos ihrer Leserschaft gelangt. Sie würde einfach weiterschreiben und weiterstrampeln wie bisher, ein anderes Talent als jenes zum Schreiben hatte sie ihres Wissens nicht.
Und dass sie in ihrer Phantasie die Welt – wie eine kleine Göttin – gestalten konnte, wie sie es sich wünschte und dabei so manches auslebte, was sie im wahren Leben nie erfahren würde, gab ihr ein Gefühl der absoluten Freiheit. Gerne riss sie auch ihre treue Leserschaft mit. Es kam zudem nicht selten vor, dass sie sich während des Schreibprozesses in einen ihrer Helden verliebte. Sie vergass dann ganz, dass er nur ein Produkt ihrer Phantasie war. Dass sie ihn so geschaffen hatte, wie er ihr selber am besten gefiel: begehrenswert, trotz Ecken und Kanten. Ihre eigene Kreatur, nicht in Stein gehauen, wie Pygmalions Galatea, aber aus Worten geschliffen.
Ihr Vater war von Beruf Maschinenzeichner gewesen und hatte dieses Metier beim bedeutenden Aufzughersteller der Region bis zu seiner Pensionierung ausgeübt. Danach aber fiel er in ein psychisches Loch. Erin, die ihn damals noch hie und da besuchte, wenn sie nicht gerade auf Lesereise war, ermunterte ihn, doch hinauszugehen, neue Leute kennenzulernen oder auch mal einen Kurs zu machen, um etwas völlig Neues zu lernen. Auch empfahl sie ihm, seine damals nur überfüllte, aber noch nicht vermüllte Wohnung endlich mal aufzuräumen. Ihre gutgemeinten Ratschläge empfand er aber mehr und mehr als Bevormundung und zudem verliess er seine Wohnung nach einiger Zeit nur noch zum Einkaufen oder zum Bezahlen seiner Rechnungen am Postschalter. Eines Tages nahm er ihr ihre Anregungen sogar so übel, dass er sie zu Hause gar nicht mehr empfing. Er öffnete ihr fortan einfach nicht mehr, wenn sie klingelte, und sagte hinter seiner verschlossenen Tür, sie könne ihn im Restaurant vis-à-vis von seiner Wohnung treffen, wenn sie wolle und ihren und seinen Kaffee bezahle. Da blieb ihr nichts anderes übrig und sie wartete im Restaurant auf ihn, wo sie nicht nur seinen Kaffee bezahlte, sondern auch den Tagesteller, den er gerne wollte. Meistens stellte sie auch noch eine Tüte neuer Unterwäsche neben ihn, die er am Ende mitnahm, ohne ihr je zu sagen, was er mit seiner Schmutzwäsche machte und ob er in seiner Wohnung überhaupt noch Zugang zu seiner Dusche hatte, da er meistens sehr ungepflegt und mit einem schlechten Geruch daherkam. Eine eigene Waschmaschine hatte er nämlich nicht und im Waschmaschinenkalender des Mietblocks war sein Name nirgends eingetragen. Das hatte Erin selber nachgeprüft.
Am Bahnhof Luzern, wo sie umsteigen musste, begab sie sich zu den Toiletten, weil sie ein dringendes Bedürfnis verspürte. Das WC in der Wohnung ihres Vaters hatte sie lieber nicht auf seine Benutzbarkeit geprüft. Beim McClean warf sie den nötigen Zweifränkler in den Automaten der Eingangsschranke, erleichterte sich schnell in einer blitzblank geputzten Toilette und wusch sich vor dem Spiegel die Hände. Dann fuhr sie sich damit durch ihr leicht gewelltes, dunkelbraunes Haar, das seit dem Tod ihres Vaters ein paar Silberfäden mehr aufwies, wie ihr schien, zog schnell ihren dezenten aprikosenfarbenen Lippenstift nach, trug auch noch etwas Mascara auf die Wimpern auf und hatte danach das Gefühl, wacher aus ihren wasserblauen Augen in die Welt zu blicken.
Danach begab sie sich wieder zur Buskante, bei welcher sie ausgestiegen war, um dort auf den nächsten Bus zu warten, der sie ins Würzenbachquartier bringen sollte. Als sie sich für einen kurzen Moment auf die metallene Wartebank setzte, vibrierte das Telefon und es erreichte sie eine Mail über die Kontaktadresse ihrer Webseite. Der Absender war wieder der Journalist Alexander Rein. Können wir uns mal treffen? schrieb er. Ich möchte Ihnen meinen Reisevorschlag näher erklären. Erin überlegte. Der Journalist schien also wirklich in Fleisch und Blut zu existieren und er hatte offenbar tatsächlich einen konkreten Vorschlag zu unterbreiten. Er siezte sie sogar, obwohl die Bekanntschaft über Facebook eigentlich das «Du» voraussetzte. Sehr suspekt kam ihr das Ganze zwar immer noch vor, aber etwas Abwechslung tat ihr ja vielleicht ganz gut. Die vermüllte Wohnung wollte sie so schnell wie möglich aus ihren Gedanken verbannen. Sie blickte auf ihre Uhr. Es war gerade dreizehn Uhr geworden und sie hatte an diesem Nachmittag keine Verpflichtungen. Da der Journalist offenbar in Zürich wohnhaft war, schlug sie ihm in ihrer Antwortmail noch am gleichen Nachmittag eine Begegnung unter der bunten, vollbusigen Schutzengelfrauenskulptur von Niki de Saint Phalle in der Zürcher Bahnhofshalle vor. Zu ihrer grossen Verblüffung war er einverstanden und sie verabredeten sich für halb drei Uhr nachmittags. Sie marschierte also kurzerhand zu den Geleisen im Bahnhof, suchte bei den Schliessfächern zuerst nach einem freien Fach, um die Plastiktüte mit der Urne hineinzustellen, fand die Idee dann aber doch etwas pietätlos und verwarf sie gleich wieder, kaufte sich über die SBB-App auf dem Smartphone das nötige Ticket und stieg in den nächsten Zug Richtung Zürich. In einem leeren Abteil setzte sie sich ans Fenster und stellte dabei die Tüte mit der Urne neben sich auf den freien Sitzplatz – ihr Vater begleitete sie sozusagen – und ihre Handtasche zwischen ihren Füssen auf den Boden. Da ihr etwas kühl war, behielt sie ihre Jacke an. Dann schaute sie sich das Profil-Foto des Journalisten bei Facebook etwas näher an. Graumeliertes, leicht gewelltes, nach hinten gekämmtes Haar hatte er, braune Augen, schmale geschwungene Lippen und ein markantes Grübchen am Kinn. Zwei weitere Grübchen waren an seinen Wangen zu erkennen, da er ein Lächeln andeutete. Sie gaben ihm etwas Verschmitztes. Er ging wahrscheinlich schon gegen die Sechzig, schätzte sie. Ein interessanter Kopf, rein vom Aussehen her, einer der sich gut als Vorlage für einen Romanhelden geeignet hätte. Aber ein kurioser Kauz war er vermutlich, denn wer bietet einer vage bekannten Frau eine Gratisreise an ohne irgendwelche Hintergedanken? Es reizte sie plötzlich, diese versteckten Beweggründe des Journalisten herauszufinden. Sie vertiefte sich gänzlich in seine Facebook-Beiträge, scrollte mehrere Jahre zurück und merkte gar nicht, wie der Zug nach einer knappen Stunde im Bahnhof Zürich einfuhr. Erst als viele Fahrgäste bereits ausgestiegen waren, blickte sie von ihrem Smartphone auf und stieg hastig aus, kurz bevor sich der Zug in entgegengesetzter Richtung in Bewegung setzte, um wieder aus dem Sackbahnhof hinauszufahren.
Auszug (1. Kapitel) aus dem Roman «Was Erin entdeckt», BoD, März 2021
Copyright Anja Siouda
Hörprobe von Anja Siouda gelesen
Noch längere Leseprobe bei amazon.de
Direktbestellung bei BoD.de (liefert portofrei innerhalb Europas)
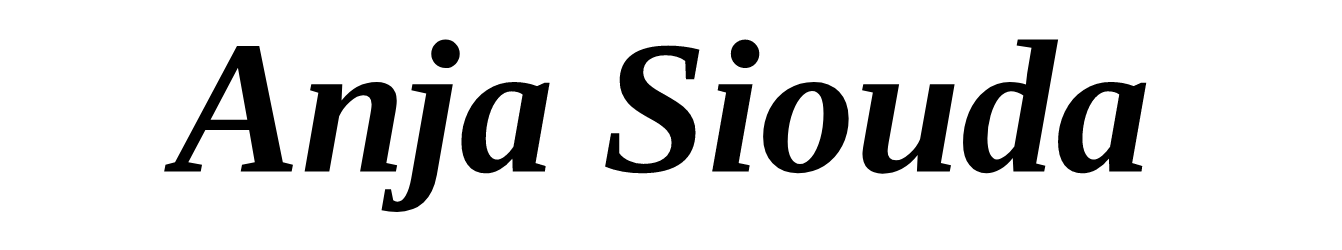

2 Comments
Spannend. Möchte gerne weiterlesen
Noch bin ich in Kolumbien und erst ab April wieder kurz in der Schweiz.
Werde lernen Bücher über ein Tablet zu lesen. Habe schon über tausend Bücher! Danke für die Leseprobe. 2 Bücher von Dir, habe ich vor Jahren schon gelesen…
Liebe Katharina, herzlichen Dank für deinen Kommentar zur Leseprobe. Natürlich freut es mich, das sie dich zum Weiterlesen motiviert. Schön, dass du bereits zwei Bücher von mir gelesen hast. Welche waren es denn?