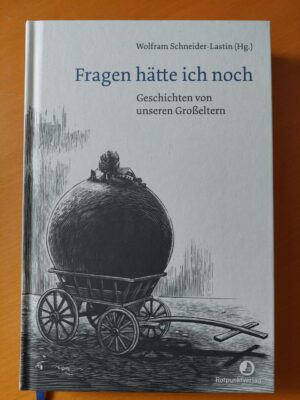
Gedanken zum Buch «Fragen hätte ich noch. Geschichten von unseren Grosseltern»
13 November 2024
Meine Mutter, die Hexe und ich
10 März 2025Sehr persönlich und anregend
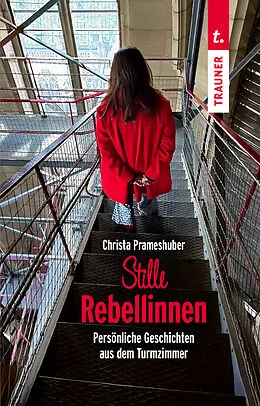
Eigentlich war mir Christa Prameshubers jüngstes Werk in den Sozialen Medien schon seit längerem aufgefallen, doch hatte ich den Titel beim flüchtigen Lesen missverstanden. Bei «Stille Rebellinnen – Persönliche Geschichten aus dem Turmzimmer», erschienen im Trauner-Verlag, hatte ich mir vorgestellt, es handle sich um Erzählungen anderer Turmeremitinnen, die Christa Prameshuber als Herausgeberin in einem Sammelband vereint hatte. Deshalb hatte ich nicht früher zu diesem Buch gegriffen, denn schon ihre «Trilogie über drei unabhängige Frauen», ihre drei bemerkenswerten Linzer Grosstanten*, die Christa Prameshuber nach dem frühen Tod ihrer Mutter aufgezogen hatten, hatte ich sehr gerne gelesen und es interessierte mich, die Autorin und ihre persönlichen Gedanken über ihr eigenes Leben, das eng mit dem Leben ihrer Grosstanten verwoben war, noch näher kennen zu lernen.
Originelle Erfahrung als Turmeremitin
Es ist eine sehr originelle Erfahrung, die die Autorin in diesem neuen Buch beschreibt. 2024 verbrachte sie im Rahmen des 2009 aufgegleisten Projektes «Turmeremit» der Diözese Linz, nach zweijähriger Wartezeit und eingehender Vorbereitung, eine Woche der Einkehr und der Ruhe im Turmzimmer des Mariendoms.
Sehr anschaulich erzählt die Autorin von ihrer Ankunft, vom Gottesdienst mit der feierlichen Schlüsselübergabe in der Krypta, vom mächtigen Glockengeläut, vom nächtlichen «Streifzug» ganz allein im Mariendom und von den Ritualen, die sie im einfachen Turmzimmer auf 68 Metern entwickelt: der Rundgang um den Turm auf dem kleinen Balkon, das Studieren des Schattenspiels des Bogenfensters, das Beobachten des Turmfalkenflugs, das Bücherlesen bis in die frühen Morgenstunden, das Schreiben der Tagebucheinträge und die täglichen, kostbaren Gespräche mit Hertha, der spirituellen Begleiterin des Domcenters. Diese einwöchige Auszeit, grösstenteils mit ihr allein, ganz ohne Internet, weckt nicht nur tiefgründige Gedanken und Glücksgefühle in ihr, sondern verändert auch ihren Blick auf die Institution der Kirche.
Negative Kindheitserfahrungen mit Religion
Mit der katholischen Religion hatte sie nämlich schon in frühen Jahren abgeschlossen. Die negativen Erfahrungen, die sie im Kindergarten machte, der von betagten Ursulinen geführt wurde, und später auch in der Kreuzschwesternschule, das Priesterzölibat, die fehlende Rolle der Frauen, all dies hatte sie zur Rebellin werden lassen. Sie trat aus der Kirche aus und sah sie nur noch als historisch-kulturelle Einrichtung.
Dass auch Marlen Haushofer auf der gleichen Klosternschule wie Christa Prameshuber gewesen war, wie die Autorin schreibt, finde ich ein interessantes Detail im Hinblick auf das Thema Eremitin, denn in der berühmten Robinsonade «Die Wand» von Haushofer, ein Lieblingsbuch von mir, lebt die Protagonistin von einem Tag auf den andern ein Eremitenleben. Allerdings unfreiwillig.
Früher Tod der Mutter
Als Christa Prameshuber mit neun Jahren ihre Mutter verlor, haderte die Grossmutter mit Gott. Bereits ihr einziger Sohn war, blutjung, im ersten Weltkrieg umgekommen. Für die verbitterte Grossmutter galt fortan: «Es gibt keinen Gott. Er hat mir beide Kinder genommen.» Diese subjektive Folgerung brannte sich in Christa Pramershubers Kinderseele ein, genauso wie die Gefühlskälte ihrer Grossmutter.
Im Turm schafft es die Autorin, nicht nur ihre Heimatstadt Linz, sondern auch ihre Grossmutter in einem anderen Licht zu sehen. Sie denkt über ihre Vergangenheit nach, die von vielen Abschieden geprägt war. Sie stellt sich auch erstmals ihrer schwersten innersten Last, der Trauer um ihre viel zu früh verlorene Mutter. Sie begibt sich auf das Grab ihrer Grossmutter und verzeiht ihr ihren Mangel an Liebe und Verständnis, woran sie sehr gelitten hatte. So kommt sie zu einer inneren Befreiung. Auch ihre eigene Kinderlosigkeit thematisiert sie.
Sie beschäftigt sich mit historisch bekannten Eremitinnen, die der Gesellschaft den Rücken kehrten, mit den nur im Turmzimmer zur Verfügung stehenden Tagebüchern der früheren Wocheneremit*innen, mit im Dom liegengebliebenen Objekten, mit Theologie und Zitaten aus der Bibel. Sie entdeckt diese sogar neu, weil die Religionspädagogin Hertha ihr rät, sie wie vom interreligiösen Brückenbauer David Steindl-Rast empfohlen als Gedichtband zu lesen. Christa Prameshuber stösst dabei zu ihrer Überraschung auch auf die ihr unbekannten Fluchpsalmen. Ich persönlich frage mich, ob ihr z.B. auch das Hohelied der Liebe kein Begriff war. Ich kam nämlich bereits in meiner Jugend damit in Kontakt, über meine als Katechetin arbeitende Mutter.
Freiwillige Beichte
Sogar zu einer freiwilligen Beichte rafft sich die Autorin auf und stösst dabei auf einen sehr aufgeschlossenen interessanten Theologen, der absolut nichts gemeinsam hat mit dem erzkonservativen Beichtvater aus Kinderzeiten, und der ihr eher den Eindruck eines Mentors vermittelt.
Gegen Ende des Buches befasst sich Christa Prameshuber mit den Anweisungen für ihr eigenes Begräbnis. Sie, die so oft mit dem Tod konfrontiert war, nimmt sich vor, die eigene Trauerrede inklusive Playlist für die Abschiedsmusik vorzubereiten, denn wer kennt ihr eigenes Leben besser als sie selbst?
Blick in ihre Seele
In all ihren niedergeschriebenen Erkenntnissen als Turmeremitin ist mir Christa Prameshuber persönlich nahegekommen. Sie lässt uns Leser in ihre Seele blicken und ich habe das Gefühl, sie nun besser zu kennen. Sie hat in diesem Buch mutig intime Fragen beantwortet, die ich (bei einer Lesung) nicht zu stellen getraut hätte. Und nicht zuletzt hat sie mich dazu angestachelt, demnächst etwas über meine eigene liebevolle, aber leider an Alzheimer leidende Mutter zu schreiben, die mir und meinen Brüdern bis zu Beginn ihrer Krankheit ihren unerschütterlichen Glauben immer als etwas sehr Positives vorlebte. Weder ihr erster noch ihr zweiter Ehemann, noch wir Kinder, teilten ihn …
Christa Prameshuber, die der Kirche und der Religion den Rücken gekehrt hatte, entdeckt sie in dieser einzigen Woche ganz neu. Wird sie am Ende wieder in die Kirche eintreten? Was könnte sie dazu bewegen?
Unerwartetes Nachwort
Im Nachwort berichtet sie von einem schockierenden Vorfall, der sich nach ihrer Eremitenwoche im Dom zugetragen hat. Dieser hat sie nachhaltig beeindruckt und sie überzeugt, dass die Kirche von innen reformiert werden muss. Daran arbeiten bereits die dreissig Domfrauen jeden Alters, die der Diözese beharrlich ihren feministischen Stempel aufdrücken.
Ich denke, mit diesem berührenden Erfahrungsbericht wird Christa Prameshuber die Warteliste für neue Eremiten-Anwärter*innen noch länger werden lassen. Sie selber hat sich übrigens auch für eine weitere Eremitage angemeldet. Auch ich könnte mir einen solchen Aufenthalt durchaus vorstellen.
*siehe dazu meine Rezension: Was für eine geniale Tante!
Anja Siouda, 7. Februar 2025

