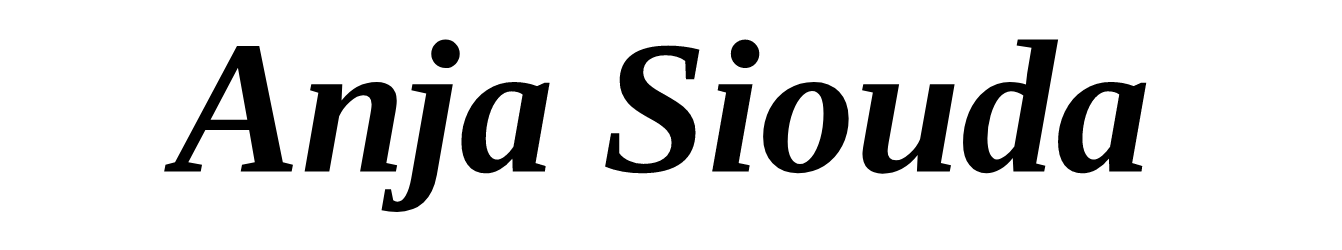José
3 Dezember 2019
Amüsantes erzähltechnisches Patchwork: Thomas Heimgartners Nekrovelle «Kaiser ruft nach»
20 Dezember 2019Wasser und Wein

Im Neuen Testament, im Johannesevangelium, verwandelt Jesus bei einer Hochzeitsfeier Wasser zu Wein. Meine Mutter, obwohl sie schon immer eine sehr gläubige Christin und als ich Kind war, sogar noch Katechetin von Beruf war, beherrschte dieses Mirakel zwar nicht, verwandelte aber beides zusammen, also Wasser und Wein, unter Zugabe von etwas Zucker immerhin in die leckerste Kinderlimonade, die es damals in unserer Familie gab. Wie viel Wein auf wie viel Wasser kam, weiss ich auch heute noch nicht, aber auf jeden Fall liebten wir diesen Durstlöscher aus dem grossen Tonkrug, den uns unsere Mutter nur im heissen Sommer auf dem Brünig, auf unserer Wochenend- und Ferienalp, zubereitete, aber davon berauscht hatten wir uns meines Wissens nie gefühlt. «Wiizuckerwasser» hiess das Getränk und das Rezept oder die Tradition stammte entweder aus dem Aargau, wo mein Vater auf einem sehr bescheidenen Bauernhof aufgewachsen war, oder aus Luzern, wo meine Mutter, Tochter eines Malers und einer Kellnerin, ihre Kindheit verbracht hatte.
Stark verdünnten Wein durften wir Kinder also auf dem Brünig ohne Weiteres trinken, hingegen warnten uns unsere Eltern eindringlich vor der gefährlichen Tollkirsche, die prall, dunkelblau und glänzend an den verschiedensten Stellen wuchs und zum Pflücken und zum Verzehr einlud. Wir hatten einen gehörigen Respekt vor dieser Beere und machten einen Bogen darum, wann immer wir sie sahen. Andere Beeren hingegen pflückten wir eifrig: Walderdbeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren und auch Holunderbeeren. Letztere allerdings erntete vor allem unser Vater, kiloweise, mit der Schere, direkt vom Baum, und presste sie dann in einer kleinen Holzpresse zu Saft, der dann, vermischt mit Zucker, zu Sirup gekocht oder später auch mal gefroren zur «gesunden» Wasserglace wurde. Der blutrote Holundersirup schmeckte uns aber auch in gefrorener Form nie so gut wie das «Wiizuckerwasser». Auf die Idee, Holunderschnaps zu machen, kam unser Vater offenbar nicht. Verdünnt und mit Zucker versüsst hätte der unserer Starlimonade vielleicht doch noch das Wasser reichen können.
An Festtagen waren wir auch oft auf dem Brünig. An Ostern zum Beispiel oder am Silvester. Vor allem das Verstecken der gemeinsam bemalten Ostereier war auf dem Brünig, mitten in der Natur, ganz besonders amüsant. Meine Mutter hatte bestimmt genauso viel Spass daran, sie für uns Kinder zu verstecken, wie wir Freude am Suchen hatten. Allerdings, bei all den Steinhaufen voller Hohlräume, den Mooskissen, den Mauslöchern, den Haselnusssträuchern und Grasbüscheln fanden wir am Ende nie alle Eier wieder. Erst Jahre später tauchte zu unserer Belustigung hie und da wieder eines dieser buntbemalten Ostereier auf … Brüchig zwar, aber immer noch farbig und gehörig stinkend, wenn die emsigen Ameisen oder die schleimigen Nacktschnecken es noch nicht ausgefressen hatten. Mit den Nacktschnecken kannten wir Kinder übrigens keine Gnade. Mit Scheren oder mit Salz bewaffnet schnitten wir sie entweder kaltblütig entzwei oder verätzten ihnen die Schleimhaut. Hätten sie schreien können, wäre ihnen unser Mitleid gewiss gewesen, ihr Leiden aber war stumm und grauenhaft wie ihr Tod. Manchmal leerten wir auch ein bisschen von dem Bier, das unser Vater ganz selten auf den Brünig mitschleppte, auf einen Marmeladeglasdeckel, damit sich die Nacktschnecken, vom Geruch angelockt, dem Sauflaster hingeben konnten – sozusagen als Henkersmahlzeit vor der Guillotine. Sie hatten wirklich kein Glück, die hässlichen Nacktschnecken. Ihr langgezogener, rostbraun glänzender Körper mit dem seltsamen Luftloch vermochte uns nicht zu entzücken, wie es etwa die riesigen Gehäuse ihrer Schwestern, der Weinbergschnecken, taten, die wir gerne sammelten. Für unsere stundenlangen Schneckenrennen wählten wir einzig Schnecken mit wunderschönen gewundenen Häusern aus. Als Jockey setzten wir den ganz grossen manchmal noch eine kleine Schnecke aufs Dach, die je nach Lust und Laune eine Weile oben blieb oder bald das Weite suchte.
Gegen Jahresende hin, mitten im Winter, wenn rund ums Haus hohe Schneemauern waren, gab es etwas anderes, das wir zwar nicht versteckten, es aber vor der Haustür unter dem kleinen Vordach in einer ganz bestimmten kalten Nacht schön kühl hielten: das leckere, selten gegessene, traditionelle «Rollschinkli», das für den Silvesterabend vorgesehen war, denn damals war mein Vater noch nicht voll auf seinem Vegetariertrip, obwohl er zusammen mit meiner Mutter bereits ein paar Are-Waerland-Kurse besucht und mit ihr im Geiste den «Weg zu einer neuen Menschheit» beschritten hatte. An jenem denkwürdigen Silvestermorgen also lag nur noch ein halb angefressenes «Rollschinkli» da, ein Fuchs hatte wohl schon eine Nacht vor uns Neujahr gefeiert, und vor allem wir Kinder waren mächtig sauer auf den Dieb! Da wir ja nicht wussten, ob der Fuchs vielleicht an Tollwut litt, durften wir von dem Angefressenen nichts abschneiden und warfen es wütend in den Wald hinunter. Ich kann mich allerdings überhaupt nicht mehr erinnern, was es an jenem Silvesterabend als Ersatz zum Essen gab. Vielleicht hat unsere Mutter ja ausnahmsweise im kalten Winter «Wiizuckerwasser» gemischt und dabei die Proportionen von Wein und Wasser etwas verändert …
Dies ist eine von 53 Erzählungen aus dem Buch „Tuttifrutti – Humoristische Erzählungen für jeden Geschmack“ von Anja Siouda. Der Erzählband ist kürzlich in einer Neuauflage als Buch und Ebook bei BoD erschienen. Die 53 Erzählungen sind unterteilt in zwölf Passionsfrüchte, zehn Zankäpfel, dreizehn Maulbeeren, neun Knacknüsse und neun Kichererbsen.
Foto: Thanks to Adriaan Greyling (Pexels)