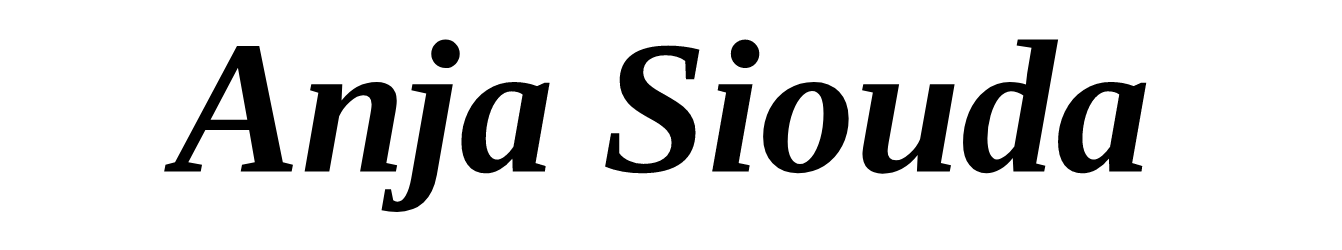Das erste Mal
19 Juli 2021
Der neue Code
11 August 2021Das muslimische Opferfest Aid-el-Kebir

Auszug aus dem Roman «Steine auf dem Weg zum Pass» (1. Teil der interkulturellen Trilogie), wo sich die muslimische Marokkanerin Halima auf der Alp auf dem Brünig in ihrem Tagebuch an das Opferfest in ihrer Heimat zurückerinnert. Seiten 265-268:
Im Namen Allahs, des Gnädigen und Barmherzigen, Mittwoch, den 27. Juli 1988, 21.00 Uhr
Ich bin todmüde, deshalb schreibe ich heute so früh. Gleich danach werde ich mich zu Bett legen. Das Heuen bei dem heissen Wetter, das Ernten der Kartoffeln, diese dicken, gelben Knollen, die ich eigentlich liebend gern aus der Erde klaube, weil ich mir dabei immer wie ein Schatzsucher vorkomme und meine viermonatige Schwangerschaft rauben mir alle Kraft. Ausserdem habe ich auch noch ein Huhn geopfert, ausgenommen und einen köstlichen Taschin zubereitet. Schliesslich ist heute, zehn Wochen nach dem Aid-es-Seghir und entsprechend meinem eigenen Kalender im Kopf, der Aid-el-Kebir, das Opferfest! Eigentlich macht mich das traurig, denn obwohl ich meine religiöse Pflicht getan und zur Erinnerung an Abraham, von dem Allah verlangt hatte, seinen Sohn Ismael zu opfern, anstelle des Lamms ein Huhn geschlachtet habe, kommt bei mir überhaupt keine Festfreude auf. Allein und nur im eigenen Herzen zu feiern ist kein Fest. Und ich muss auch daran denken, dass Vater und Mutter wahrscheinlich immer noch nicht unter den Pilgern sind, die dieses Jahr zu den Hunderttausenden von Wallfahrern aus aller Welt gehören, die in Mekka zum Haddsch zusammenströmen. Hatte ich Mutter und Vater vor meinem Abflug nach Zürich nicht versprochen, dass ich in der Schweiz nur ganz wenig Geld brauchen würde, um den Rest sparen und ihnen schicken zu können, damit ihr Traum von der Pilgerfahrt endlich in Erfüllung ginge? Das hatte ich nicht einfach so dahergeredet, sondern es war mir völlig ernst gewesen. Welches Kind möchte seinen alten Eltern diesen Wunsch nicht erfüllen, damit sie dem Tode furchtlos entgegensehen können, weil sie wissen, dass sie neben dem Glaubensbekenntnis, dem Gebet, dem Fasten und dem Almosengeben auch diese religiöse Pflicht erfüllt haben?
Ach, und überhaupt, ein Huhn ist kein Lamm! Das ist nicht so viel dran und obwohl das Ausrupfen der Federn viel einfacher ist als das Abziehen des Lammfells, macht das den Genuss, den man hat, wenn man sich im Winter die kalten Füsse am flauschig weichen Fell wärmen kann, in keiner Weise wett.
Wie lustig ich es als Kind immer fand, wenn mein Vater, nachdem er dem Lamm im Namen Allahs die Kehle durchgeschnitten hatte und das Blut hatte auslaufen lassen, dem toten Tier das Fell abzog. Dafür trennte er ihm die untere Hälfte der Beine ab, machte einen Einschnitt beim Ansatz der Haut und blies hinein, damit sie sich vom Fleisch ablöste und er sie nachher leichter abziehen konnte. Obwohl das Lamm mit seinem aufgeblähten Körper aussah, als hätte es zwei Wochen im Wasser gelegen, stellte ich mir jeweils vor, es würde plötzlich wie ein höhnisch blökender, vierbeiniger Riesenballon über unseren Köpfen davonschweben. Meistens bekam ich dann einen unbändigen Lachanfall und Vater schimpfte mich einen gotteslästerlichen Balg. Dann nahm er es aus, wusch die Innereien und gab meiner Mutter den Kopf, damit sie auf dem niedrigen Gasbrenner die Haare absengen konnte. Das Hirn, das Herz, die Leber, die Nieren, den Magen und die Hoden, falls es ein junger Bock gewesen war, assen wir immer gleich am ersten Tag. Auch die Därme, die gründlich gewaschen wurden, schnitt Mutter auseinander und briet sie im heissen Öl für mich, denn ich war die Einzige, die diese dünnen, knusprigen Häute mochte.
Vom restlichen Fleisch bekamen Nachbarn und Verwandte sowie die Armen im Dorf jeweils ein Drittel. Das letzte Drittel gehörte uns, aber weil wir eine sechsköpfige Familie waren, war das Fleisch nach wenigen Tagen gegessen und kam während der restlichen Zeit des Jahres praktisch nicht mehr auf den Tisch.
Vom Opferfest in der Stadt habe ich kaum Erinnerungen. Es war einfach weniger eindrücklich, wenn Vater das Lamm nur noch mit einem Nachbarn kaufen konnte, das laut blökende Tier mit ihm zusammen gefesselt die acht Etagen hochtrug und ihm in der Badewanne unseres winzigen Badezimmers die Kehle durchschnitt.
Nein, weniger eindrücklich ist nicht der richtige Ausdruck. Irgendwie entwürdigend wirkte es auf mich, für das Schaf und für das Opferfest!
Copyright Anja Siouda
Auszug aus dem Roman «Berührte Blüten» (3. Teil der interkulturellen Trilogie), wo die christliche Schweizerin Elena in Tunis ihre Gedanken und Eindrücke zum Opferfest preisgibt. Seiten 219-223:
Tunis, Aid el-Adha, 15. Oktober 2013
Zum Salat al-Aid, dem Morgengebet in der Moschee am ersten Tag des Opferfestes, dem wichtigsten islamischen Fest, das jeweils am zehnten Tag des islamischen Monats Dhu-el-Hadscha stattfand und welches gemäss dem Koran auf Abraham zurückging, der von Gott auf seinen Gehorsam geprüft worden war, indem er ihm den Auftrag gegeben hatte, seinen einzigen Sohn Ismael zu opfern, wobei in letzter Minute der Engel Gabriel mit einem Schaf aufgetaucht war, das Abraham dann an Ismaels Stelle hatte opfern dürfen, liess Elena Qais, seinen Vater und Batul alleine gehen. Safia und die Schwiegermutter Fatma blieben auch zu Hause, aber Elena hatte keine Lust, wartend oder in der Küche arbeitend zu Hause zu bleiben und nach Qais‘ Rückkehr zuzuschauen, wie er als Ältester – sein Vater war zu schwach dazu – dem Schafbock, der schon seit einer Woche verloren und einsam blökend durch den Obstgarten streifte, nachdem Qais ihn für vierhundert Dinar auf dem Markt gekauft hatte, mit Hilfe eines Nachbarn im Innenhof im Namen Gottes die Kehle durchschneiden würde. Sie spazierte also ein wenig durchs Quartier, wo schon seit Tagen Stroh auf den Strassen herumlag und wo man hie und da ein Blöken hörte. Dies erinnerte sie ganz stark an Daphne und Penelope auf dem Brünig und störte sie natürlich überhaupt nicht, ganz im Gegensatz zu den Lachen von Blut in manchen Hinterhöfen. Zwar war sie, das musste sie zugeben, keine Vegetarierin und ass ab und zu selber auch gerne ein Stück Fleisch, aber diese freudige Massenschlachterei – wobei es laut Qais in den letzten Jahren meist auch noch darum ging, wer den schönsten Schafbock opferte –, in jedem Hinterhof, aber auch auf Parkplätzen, machten ihr wirklich Mühe. So viele tunesische, teilweise aber auch aus Spanien extra importierte Schafböcke mussten hier am Opfertag ihr Leben lassen, aber immerhin waren sie vorher wahrscheinlich ihr Leben lang draussen auf einer Weide gewesen, hatten ein artgerechtes Leben als fleissige Wiederkäuer geführt und ihre letzten Tage und Stunden nicht etwa total gestresst in einem überfüllten Lastwagen verbracht, sondern als Spielkameraden der Kinder in den Gärten und Höfen der Familien, wenn nicht direkt in der Wohnung. Das Fleisch, das es am Opferfest zu essen gab, war für die Menschen auch ein einzigartiges Festessen, denn Fleisch war im Alltag extrem teuer und kam nur selten auf den Tisch. Wer wollte es den Muslimen also verdenken, dass sie sich dermassen auf diesen Festtag und das einmalige Festessen freuten? Und waren die Muslime, die sich selber um das Töten des Tiers kümmerten, das sie essen wollten, nicht auch ehrlicher? Das Schlachten und Zerteilen war schliesslich wahre Knochenarbeit, kein beschaulicher Job, und die Kinder lernten von Anfang an, dass man Fleisch nur dann essen konnte, wenn dafür auch ein Tier starb. Kein Vergleich mit den klinisch sauber abgepackten Edelstücken in europäischen Supermärkten, wo die Menschen aus ihrem Gewissen ausblendeten, dass jedes Stück Fleisch von einem Tier herstammte, dem man das Leben genommen hatte. Eine Scheuklappenhaltung, die bisweilen auch an landwirtschaftlichen Ausstellungen anzutreffen war, wenn Kinder an einem Stand beispielsweise Kühe, Rinder und Kälbchen streichelten, drei Stände weiter aber das Trockenfleisch degustierten, ohne überhaupt eine gedankliche Verbindung zwischen dem lebenden Tier und der Fleischspezialität herzustellen.
Als Elena in ein Taxi stieg und sich aufs Geratewohl von La Soukra nach Ariana fahren liess, sah sie in einigen Quartieren, dass die Fassaden direkt unter den Balkonen blutüberströmt waren, weil die Menschen den Schafen direkt auf dem Balkon die Kehle durchgeschnitten hatten. Elena schauderte es bei diesem Anblick, daran würde sie sich wohl nie gewöhnen, und sie wünschte sich in diesem Moment auf ihre ruhige, menschenleere Alp und zu Daphne und Penelope zurück. Sie wies den Taxifahrer schliesslich an, sie in der Gegenrichtung nach Sidi Bou Said zu fahren, wo sie im ihr bekannten Café des Délices mitten unter ein paar wenigen Touristen einen Espresso bestellte und eine Weile verloren aufs tiefblaue, betörende Meer starrte. Wie wohl Amina und Mohammed das Opferfest feierten, fern ihrer Familie? fragte sie sich und musste sich alle Mühe geben, ihren erneuten Anflug von Wut zu unterdrücken, weil ihr Gerechtigkeitsverständnis wieder voller Wucht aufbegehrte.
Als Elena wieder zu Qais und seiner Familie zurückkehrte, war der Schafbock bereits ausgeblutet, enthäutet und in Stücke zerteilt. Der Vater von Qais hatte sich mit der rechten Schulter des Schafes zu bedürftigen Menschen in der Nachbarschaft aufgemacht, während Batul die linke Lammschulter gerade mit Kurkuma und Salz einrieb, um sie danach an der Sonne zu Trockenfleisch werden zu lassen. Safia war damit beschäftigt, die Därme für die Merguez und die Mägen für die Osbane zu waschen, während Fatma gerade den Schafkopf in den Ofen schob, wo er, Mosli genannt, zusammen mit Kartoffeln, Pfeffer, Salz und Kurkuma schmoren sollte. Qais bereitete gerade den grossen Grill im Garten fürs Meschoui vor, um darauf eine der beiden Hammelkeulen zu braten. Als er Elena neben ihm auftauchen sah, fragte er stirnrunzelnd, wo sie denn die ganze Zeit über verblieben sei, er habe sich schon beinahe Sorgen gemacht.
«Ich wollte nicht zuschauen, wie du dem Schafbock die Kehle durchschneidest», sagte Elena einfach.
Qais aber lachte nur und meinte: «Da dran wirst du dich schon noch gewöhnen mit der Zeit.»
Copyright Anja Siouda